Die Flamme brennt
Ich habe sie in mir, diese lodernde Flamme, die vom Glauben genährt wird, dass Bildung anderes gestaltet werden muss, als es aktuell an den meisten staatlichen Regelschulen geschieht. Sie brennt stetig und flackert immer mal wieder stärker auf, wenn ich Filme sehe wie „Alphabet“ oder „Schools of Trust“, wenn ich Bücher lese von Remo Largo, Rebeca Wild oder Alfie Kohn, wenn ich die aktuell immer stärker wachsende unerzogen-Bewegung beobachte, wenn ich freie demokratische Schulen besuchen darf, wenn ich meine eigenen (noch nicht schulpflichtigen) Kinder betrachte – ihre Neugierde auf das Leben, ihr „Einsaugen“ von Informationen ohne Lehrplan – , und nicht zuletzt: Wenn ich jeden Tag in eine staatliche Regelschule gehe. Denn dort arbeite ich.
Und, hey, ich sehe so viel Gutes an meiner Schule: Die vielen den Schülern[1] sehr zugewandten Kollegen und wie viel sie möglich machen; dass es einfach ist, zwischen den Schulzweigen zu wechseln; es herrscht wenig körperliche und verbale Gewalt zwischen den Menschen.
Vor allem sind da so viele tolle Schüler. Deswegen gehe ich gerne dort hin.
Alltag an staatlichen Schulen
Was ich aber auch sehe sind viele frustrierte Kollegen und noch mehr frustrierte Schüler. Schüler, die unter einem immensen Druck stehen, die jeden Tag versuchen, Erwartungen zu erfüllen: Erwartungen der Eltern, Erwartungen der Lehrer – mit fortschreitendem Alter haben die meisten Schüler diese Erwartungen so internalisiert, dass sie sie an sich selbst stellen mit einer Vehemenz, die mich bei Erwachsenen sehr nachdenklich stimmen würden. Bei Kindern und Jugendlichen schockiert sie mich.
Ich sehe Schüler, die aufgeben, die sich selbst aufgeben, die bei mir um Entschuldigung bitten – für ihre Dummheit, ihre Faulheit, ihre Störverhalten.
Ich sehe gelangweilte Schüler, die so vieles an Inhalten als unnötig betrachten, deren Motivation zu lernen fast vollständig abhanden gekommen ist.
Ich sehe ängstliche Schüler, die Sorge haben, zu scheitern, die mit jeder „schlechten“ Note ihre Zukunft in Frage stellen – eine Zukunft, die sowieso in vielen Fällen im Dunkeln liegt: Viele Schüler sind ohne Perspektive, wissen nicht, was sie später tun wollen, kennen nicht ihre Stärken, ihre Interessen, ihre Leidenschaften – dafür hat der Schulalltag ihnen wenig Platz gelassen, zu weit weg ist die Welt da draußen. Ein Großteil besucht die Schule irgendwann nicht mehr, um etwas zu lernen, meist geht es darum, Zeit zu gewinnen für das Danach – was immer das auch sein mag.
Es sind schon die kleinen Dinge, die mich verwundern: Die Frage, ob man auf die Toilette gehen dürfe – während ich genau weiß, dass diese Schüler in regelmäßigen Abständen dazu aufgefordert werden, Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen.
Das passt nicht.
Was kann ich ändern?
Wie kann ich diesen Schulalltag mit meinen Werten in Einklang bringen? Ich versuche, trotz des Machtgefälles, positive Beziehungen zu meinen Schülern aufzubauen, ihnen Empathie entgegen zu bringen und mir meine Neugierde für jeden dieser Menschen zu bewahren.
Ich versuche so gut es geht Entscheidungsfreiheiten in den Inhalten zu geben, interessenorientiert arbeiten zu lassen. Hier wird es offensichtlich: Solange ich diejenige bin, die die Macht hat, Freiheit zu geben oder zu verwehren, wird das Gefälle weiterhin existieren.
Ich suche mir in der Schulstruktur meine Nischen ohne Bewertung, mit freiwilliger Teilnahme: Durch AG-Angebote kann ich kleine Inseln schaffen.
Das System arbeitet gegen mich
Doch das System arbeitet gegen mich: Ich muss Noten geben, muss die Schüler bewerten. Das tötet jede intrinsische Motivation. Viele Schüler lernen ausschließlich für die Noten – das formulieren sie auch so.
In der Oberstufe bereite ich mich mit den Schülern auf das Abitur vor, in dem bestimmt Inhalte parat sein müssen – das war es mit der Entscheidungsfreiheit bezüglich der Inhalte. Und sollte eine Lerngruppe oder auch einzelne Schüler entflammen für ein Thema, so bleibt keine Zeit, denn das nächste Thema wartet schon.
Die Schüler sind in Jahrgangsstufen eingeteilt – will ich einem Schüler Entwicklungs-Zeit geben, müsste ich ihn zurücksetzen (was als Niederlage gewertet wird). Und was ist, wenn er in Mathematik den Anforderungen einer Jahrgangsstufe genügt, in Englisch allerdings nicht? Die Zürcher Longitudinalstudien[2] werden an dieser Stelle völlig missachtet.
„Bis zur Oberstufe nehmen die Unterschiede zwischen den Kindern nochmal deutlich zu. Mit 13 Jahren variiert das Entwicklungsalter um mindestens 6 Jahre zwischen den am weitesten entwickelten Kindern und jenen, die sich am langsamsten entwickeln.“
Remo H. Largo in „Schülerjahre“
Den Schülern fehlt an vielen Stellen die Kompetenz zu lernen – die Entwicklung von Motivation, die Strukturierung von Inhalten, die Organisation der Materialien. Da gibt es dann die, die von Hause aus eine Menge Unterstützung erfahren, sie haben es um so vieles leichter. Diejenigen, deren Eltern das nicht leisten können, haben an dieser Stelle schon fast verloren. Das ist soziale Selektion. Trotz Fördermaßnahmen und Einführung von A(rbeits)-und-Ü(bungs)-Stunden sehe ich da wenig Verbesserung. Ja, die Zeit fehlt.
Wir produzieren Schüler, die abhängig sind vom Lob und der Zustimmung von Autoritätspersonen – das erlebe ich häufig, wenn ich mich weigere, dem erarbeiteten Ergebnis einer Lerngruppe zuzustimmen oder es zu kritisieren: Es macht die Schüler geradewegs aggressiv, wenn sie keine Rückmeldung erhalten. Es fehlt das Vertrauen in die eigene Leistung.
Wir erziehen die Schüler zu Konkurrenten und Einzelkämpfern – da kann im Unterricht noch so viel kooperatives Lernen stattfinden, da kann noch so viel erfahrbar gemacht werde, wie wertvoll der Austausch vieler Ideen ist – in der Prüfungssituation stehen sie alleine da. Noten dienen dem sozialen Vergleich.
Der Großteil meiner Schüler ist nicht in der Lage, Aufgaben zu lösen, die freies Denken erfordern – zu fest ist der Glaube, dass nur Auswendiggelerntes Erfolg bringen könne. Ist dies bei einem Problem nicht einsetzbar, ergreift sie die Panik. Die Schüler sind darauf „programmiert“ die „richtige“ Lösung zu reproduzieren – das gibt ihnen Sicherheit. Solche Lösungen gibt es im wahren Leben allerdings sehr selten…
All dies macht Leidenschaft fürs Lernen, Mut zur kreativen Problemlösung unmöglich.
Was Schüler brauchen
Schüler, einfach alle Menschen, brauchen Erfolgserlebnisse.
Sie brauchen eine nicht-bewertende Rückmeldung mit der Möglichkeit, sich weiter zu entwickeln. Schüler brauchen eine freie, interessenorientierte Fach- und Inhaltsauswahl und zwar dann, wenn sie soweit sind und/oder ein Interesse dafür entwickeln. Vielleicht werden sie sich für bestimmte Themen nie interessieren (Ich oute mich mal: Ich kann keine Integralrechnung. Ich will es auch nicht können. Ich habe sie in den letzten 22 Jahren nicht vermisst.).
Sie brauchen Vertrauen in ihre eigene Kompetenzen.
Sie brauchen Mut, ihre eigene Welt zu gestalten und sie nicht von Gestaltern abhängig zu machen. Sie brauchen keine Lehrer, die ihnen sagen, was falsch oder richtig ist. Sie brauchen Begleiter, die sie unterstützen in ihrem ganz individuellen, selbstgewählten Entwicklungs- und Bildungsweg, zu denen sie Beziehungen aufbauen können.
Wenn wir unsere Kinder vorbereiten wollen auf eine Zukunft, von der wir nicht wissen, wie sie aussehen wird, dann müssen wir ihnen unendlich viel Vertrauen entgegenbringen und in ihnen so die Entwicklung eines Vertrauen in sich selbst ermöglichen. Sie müssen Mut haben dürfen, Fehler zu machen. Sie müssen kreativ sein dürfen und vielleicht Wege wählen können, die uns auf den ersten Blick fragwürdig erscheinen. Sie müssen sein dürfen.
Revolution der Bildungslandschaft
Viele dieser Aspekte sind Grundsätze demokratischer Schulen: Selbstbestimmtes und -gesteuertes Lernen, jahrgangsübergreifendes gemeinsames Lernen, Beurteilungen nur auf ausdrücklichen Wunsch der Schüler, demokratische Mitentscheidung in allen Belangen durch die Schüler. Das Lernen so funktioniert bestätigen Neurophysiologen und Bildungsforscher ebenso (vgl. z.B. Gerald Hüther (2016): „Mit Freude lernen – ein Leben lang“ oder Remo H. Largo (2016): „Lernen geht anders. Bildung und Erziehung vom Kind her denken“). Sie ist also möglich, machbar und vielerorts wird sie gelebt, diese Form der Bildung.
Ich stelle es mir traumhaft vor, an solch einem Ort mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen arbeiten zu dürfen, dabei sein zu können, zu begleiten. Zu sehen, dass sich das Vertrauen in das Bedürfnis nach Lernen und Weiterentwicklung eines jeden Menschen lohnt.
Trotzdem arbeite ich immer noch an einer staatlichen Schule. Warum? Demokratischen Schulen besuchen Schüler, die aus entsprechenden Elternhäusern kommen. Die sehr viel Unterstützung erfahren in ihrem eigenen Weg. Meine Schüler haben in der Regel einen anderen Hintergrund. Auch in ihnen kann ich eine Flamme entzünden. Ich kann versuchen, heute schon im Mikrobereich der staatlichen Schulen Veränderungen zu schaffen, soweit es das System zulässt. Und: Ich kann aufzeigen, dass es Alternativen gibt. Die wenigsten Schüler wissen, dass es freie demokratische Schulen gibt und es erscheint ihnen wie ein Märchen. Damit sollen sie sich auseinandersetzen können. Denn haben sie nicht jetzt die Macht, ihren Bildungsweg selbst zu gestalten, so können sie in der Zukunft vielleicht einen anderen Weg für ihre eigenen Kinder wählen. Die Revolution beginnt bei den Wurzeln. Ich muss (noch) bleiben, um den Schülern so weit es geht vorleben zu können, dass es auch anders sein kann. Ich kann sie (noch) nicht alleine lassen.
Ich glaube daran, dass diese Revolution der Bildung kommen wird. Wir alle müssen umdenken. Die Flamme brennt in Vielen: So viele Menschen setzen sich angeregt mit diesem Thema auseinander. Die Gründungsinitiativen für freie Schulen sprießen wie Pilze aus dem Boden. Die staatlichen Schulen müssen sich neu positionieren und die Erkenntnisse der Bildungs- und Entwicklungsforscher umsetzen, denn es geht nicht um einen Wettkampf zwischen „besser“ und „schlechter“, sondern um unsere Zukunft.
Jesper Juul spricht im Film „Schools of Trust“ von einem Tsunami, der kommt, innerhalb der nächsten 10 Jahren. Ich freue mich darauf.
________________________________
[1] Aus Gründen der Lesbarkeit wird im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf Angehörige aller Geschlechter.
[2] Die Zürcher Längsschnittstudie dokumentiert und analysiert seit 1954 das Wachstum und die Entwicklung von Kindern von der Geburt bis ins Erwachsenenalter (vgl. Remo H. Largo, Oskar G. Jenni (2005): „50 Jahre Forschung in den Zürcher Longitudinalstudien. Was haben wir daraus gelernt?“, in: Arbeitsstelle Frühförderung Bayern (Hrsg.): Forschung für die Praxis – Wie funktioniert kindliche Entwicklung?“, S. 47-56.)
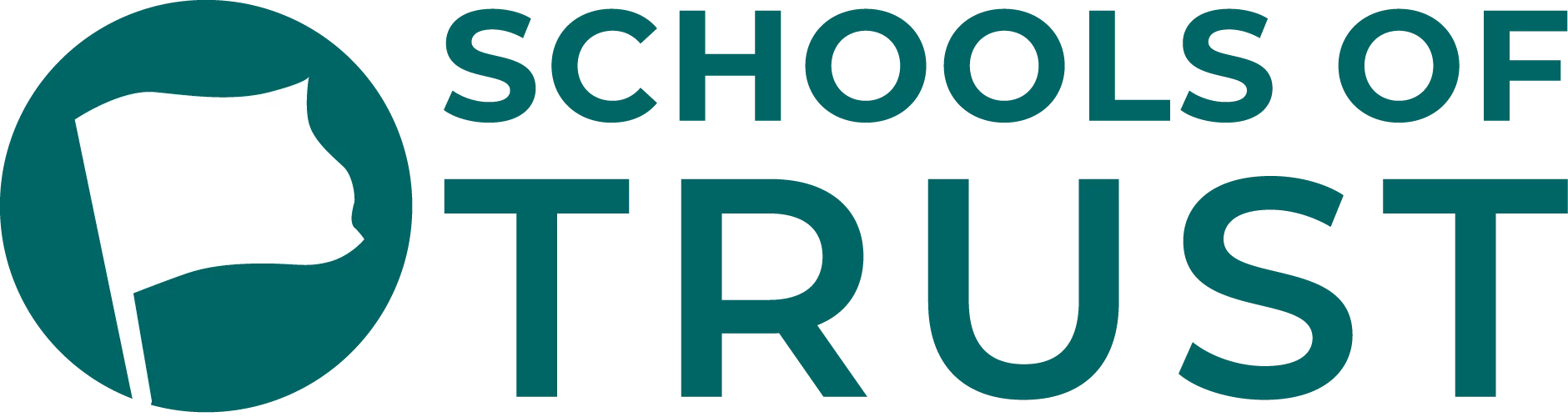


2 Antworten
Liebe Katharina,
der Artikel spricht mir so sehr aus dem Herzen, dass er von mir hätte sein können. Ich bin in der gleichen Rolle wie du. Unterrichte an einer staatlichen (Grund-)schule und brenne für die Idee freier Schulen. Oft fühle ich mich jedoch zerrissen zwischen den eigenen Idealen, deren positive Wirkung ich bei meinen eigenen Kindern sehen kann, und der Realität in der Schule. Über einen Austausch mit Gleichgesinnten freue ich mich immer. Es wäre toll, wenn wir in Kontakt kommen könnten.
Danke für diesen Artikel!
Liebe Katharina, vielen, vielen Dank für deinen wundervollen Text! Du sprichst mir aus der Seele!!!! Liebe Grüße, Kerstin